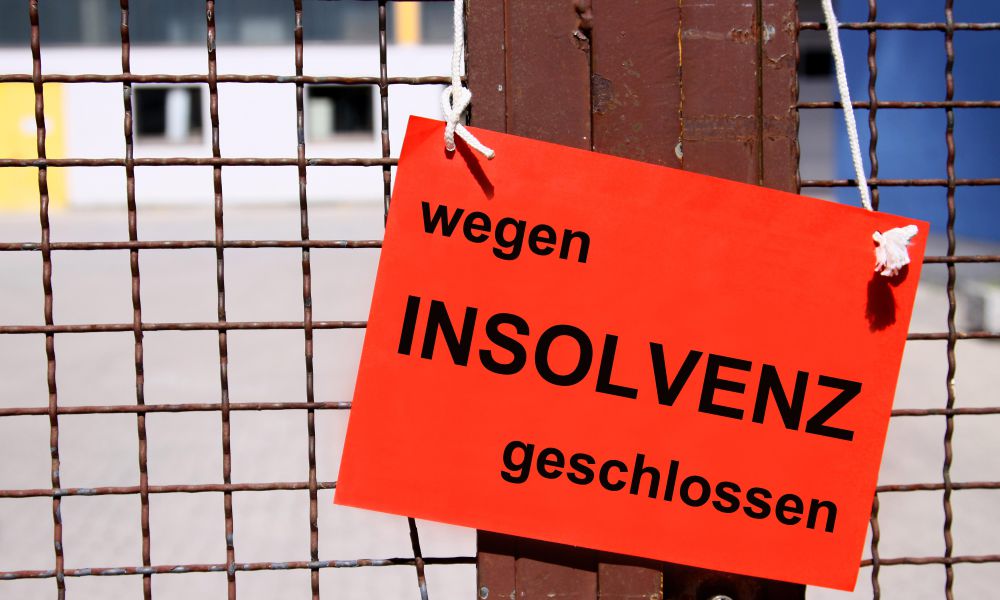Insolvenzpflicht: Was Unternehmer jetzt wissen müssen
Was bedeutet „insolvenzreif“?
Ein Unternehmen ist insolvenzreif und muss einen Insolvenzantrag stellen, wenn einer der gesetzlichen Eröffnungsgründe vorliegt:
• Zahlungsunfähigkeit (§ 17 InsO),
• drohende Zahlungsunfähigkeit (§ 18 InsO) oder
• Überschuldung (§ 19 InsO).
Sobald einer dieser Tatbestände erfüllt ist, besteht für die Geschäftsleitung Handlungsdruck mit Blick auf gesetzliche Melde- und Antragspflichten.
Wann liegt Zahlungsunfähigkeit vor?
Zahlungsunfähigkeit besteht, wenn das Unternehmen seine fälligen Rechnungen mit den vorhandenen liquiden Mitteln nicht mehr begleichen kann. Als praktischer Maßstab hat sich eine Liquiditätslücke von 10% der fälligen Gesamtverbindlichkeiten etabliert: Liegt die Lücke bei 10 % oder mehr, ist regelmäßig von Zahlungsunfähigkeit auszugehen. In diesem Fall muss innerhalb von drei Wochen ein Insolvenzantrag gestellt werden. Regelmäßige Liquiditätsprüfungen sind daher unverzichtbar.
Was versteht man unter drohender Zahlungsunfähigkeit?
Von drohender Zahlungsunfähigkeit spricht man, wenn absehbar ist, dass das Unternehmen künftige Zahlungsverpflichtungen nicht fristgerecht erfüllen kann. Für die Beurteilung ist üblicherweise ein Prognosezeitraum von bis zu 24 Monaten maßgeblich. Ein Antrag kann hier zwar gestellt werden, jedoch besteht hierfür keine zwingende Pflicht.
Wann ist Überschuldung gegeben und wie wird die Fortführung nachgewiesen?
Überschuldung besteht, wenn das Vermögen, die Verbindlichkeiten nicht mehr deckt, es sei denn, die Fortführung des Unternehmens ist für die nächsten zwölf Monate überwiegend wahrscheinlich. Bei Kapitalgesellschaften (z. B. GmbH, AG, UG) muss die Geschäftsleitung nachweisen, dass eine 12-monatige Durchfinanzierung gesichert ist. Übliches Instrument ist die Fortführungsprognose, die auf drei Elementen basiert:
• plausibles Geschäftskonzept mit Soll-Verlauf,
• darauf abgestimmter Finanzplan und
• die daraus resultierenden Fortführungsprognosen.
Wer muss den Insolvenzantrag stellen und welche Fristen gelten?
Die Pflicht zur Stellung eines Insolvenzantrages liegt grundsätzlich bei der Unternehmensleitung (Eigenantrag). Gläubiger können ebenfalls Fremdanträge einreichen (z. B. Finanzamt, Sozialversicherungsträger). Die wichtigsten Fristen:
• Zahlungsunfähigkeit: Insolvenzantrag innerhalb von drei Wochen nach Eintritt,
• Überschuldung: Insolvenzantrag innerhalb von sechs Wochen,
• Drohende Zahlungsunfähigkeit: keine zwingende Antragsverpflichtung.
Welche haftungs- und strafrechtlichen Risiken bestehen für Geschäftsleiter?
Wer einen Insolvenzantrag nicht, nicht rechtzeitig oder fehlerhaft stellt (Insolvenzverschleppung), macht sich straf- und zivilrechtlich angreifbar. Zahlungen, die nach Eintritt der Insolvenzreife das Vermögen der Gesellschaft mindern, können nach § 15b InsO zur persönlichen Haftung des Geschäftsleiters führen. Dabei drohen strafrechtliche Sanktionen (z. B. nach § 15a InsO), die Geldstrafen oder Freiheitsstrafen zur Folge haben können. Bei Einzelunternehmern besteht grundsätzlich ein höheres Risiko der persönlichen Haftung.
Welche praktischen Handlungsempfehlungen gelten jetzt?
• Führen Sie regelmäßige Liquiditätschecks durch und dokumentieren Sie die Ergebnisse.
• Erstellen Sie bei Unsicherheit eine Fortführungsprognose mit Finanzplan.
• Ziehen Sie eine ordnungsgemäße fachliche Beratung hinzu, bevor Fristen ablaufen oder Liquiditätsschwächen sich verschlimmern.
• Vermeiden Sie Zahlungen nach dem Eintritt der Insolvenzreife, die die Insolvenzmasse mindern.
Was bedeutet Restschuldbefreiung?
Die Restschuldbefreiung ist das rechtliche Verfahren, durch das eine natürliche Person nach Beendigung eines Insolvenzverfahrens von den noch bestehenden, nicht erfüllten Forderungen befreit werden kann. Ziel ist die wirtschaftliche Entschuldung des Schuldners, damit ein wirtschaftlicher Neustart möglich wird.
Wer kann Restschuldbefreiung erhalten?
Grundsätzlich kommen natürliche Personen in Betracht – dazu zählen private Verbraucher und selbständige Einzelunternehmer. Kapitalgesellschaften (z. B. GmbH, AG, UG) können keine Restschuldbefreiung für die Gesellschaftsverbindlichkeiten erhalten; für Geschäftsführer kann jedoch eine persönliche Insolvenz möglich sein.
Welche Voraussetzungen und Abläufe gelten?
• Eröffnung eines Verbraucher- oder Regelinsolvenzverfahrens mit Verwertung / Abwicklung durch den Insolvenzverwalter bzw. Treuhänder.
• Nach Feststellung der Insolvenz und Durchführung des Insolvenzverfahrens folgt die sogenannte Wohlverhaltensphase (auch: Wohlverhaltensperiode). Während dieser Phase müssen die Schuldner kooperieren, etwa pfändbares Einkommen abtreten, keine ungesicherten Verträge eingehen und erforderliche Mitwirkungshandlungen neu erbringen.
• Nach erfolgreichem Abschluss der Wohlverhaltensphase wird die Restschuldbefreiung erteilt; Verbleibende, vor der Insolvenz entstandene Forderungen dürfen die Gläubiger danach grundsätzlich nicht mehr verfolgen.
Wie lange dauert die Wohlverhaltensphase?
Die Dauer kann variieren; Durch Reformen wurde die Möglichkeit einer verkürzten Dauer eingeführt. Üblich sind Zeiträume zwischen drei und sechs Jahren, abhängig davon, ob der Schuldner ausreichende Zahlungen leistet und die gesetzlichen Voraussetzungen für eine Verkürzung erfüllt. Konkrete Fristen und Voraussetzungen sollten aktuell geprüft werden.
Welche Ansprüche bleiben von der Restschuldbefreiung ausgenommen?
Typischerweise sind Unterhaltsansprüche privilegiert und bleiben regelmäßig erhalten. Auch bestimmte strafrechtliche Ansprüche oder Geldstrafen sowie in einigen Fällen öffentlich-rechtliche Ansprüche (abhängig von ihrer Natur) können unberührt bleiben. Ob konkrete Forderungen aus der Befreiung erfasst werden, ist einzelfallabhängig.
Welche Folgen hat die Restschuldbefreiung für Unternehmer?
Für Einzelunternehmer bedeutet die Restschuldbefreiung die Möglichkeit, sich privat von betrieblichen Altschulden zu befreien. Allerdings können sich vor und während des Verfahrens steuerliche Konsequenzen ergeben (z. B. Besteuerung von Sanierungsgewinnen) und die Befreiung entbindet nicht notwendigerweise von allen öffentlich-rechtlichen Ansprüchen. Zudem sind künftig wiederkehrende Geschäftsaufnahme- und Kreditchancen eingeschränkt.
Was ist zu beachten und welche Schritte sind empfehlenswert?
• Frühzeitige Beratung: Vor Einleitung eines Insolvenzverfahrens sollte stets eine fachliche Beratung erfolgen, um Vor- und Nachteile sowie mögliche Alternativen (Vergleich, Sanierungsmaßnahmen) abzuwägen.
• Vollständige Mitwirkung: Alle erforderlichen Angaben gegenüber dem Insolvenzverwalter und die fristgerechte Erfüllung der Mitwirkungspflichten sind entscheidend für den Erfolg der Restschuldbefreiung.
• Steuerliche Prüfung: Mögliche steuerliche Folgen (z. B. Sanierungsgewinn) zeitnah prüfen lassen.
• Keine voreiligen Zahlungen: Zahlungen nach Eintritt der Insolvenzreife können haftungsrechtliche Folgen für den Schuldner und die Gläubigerstruktur haben.
Kernaussagen in Kürze
• Insolvenzreife tritt bei Zahlungsunfähigkeit, drohender Zahlungsunfähigkeit oder Überschuldung ein.
• Bei Zahlungsunfähigkeit ist der Insolvenzantrag innerhalb von drei Wochen, bei Überschuldung innerhalb von sechs Wochen zu stellen.
• Für Kapitalgesellschaften ist eine 12-monatige Fortführungsprognose der Nachweis gegen Überschuldung.
• Geschäftsleiter riskieren zivil‑ und strafrechtliche Konsequenzen bei verspäteter oder ausbleibender Antragstellung.
• Restschuldbefreiung ermöglicht natürlichen Personen die Entschuldung nach abgeschlossenem Insolvenzverfahren und erfolgreicher Wohlverhaltensphase.
• Anspruchsberechtigt sind Verbraucher und Einzelunternehmer; Kapitalgesellschaften sind ausgeschlossen.
• Die Wohlverhaltensphase dauert täglich 3–6 Jahre; Bei Erfüllung bestimmter Voraussetzungen kann eine Verkürzung eintreten.
• Einige Forderungen (z. B. Unterhalt, bestimmte öffentlich-rechtliche Ansprüche) können von der Befreiung ausgenommen sein.
• Steuerliche und haftungsrechtliche Folgen sollten vorab genau geprüft werden.
Tipp!
Bei Einzelfragen sprechen Sie bitte die Mitarbeiterinnen der Kanzlei an. Insolvenzangelegenheiten sind Rechtsangelegenheiten über die, die Kanzlei nur im Rahmen der steuerlichen Rechte und Pflichten beraten darf. Wir können aber Kontakte zu spezialisierte Rechtsanwaltskanzleien herstellen.
Stand: 17. September 2025
Die vorstehenden Informationen sind nach bestem Wissen und Kenntnisstand erstellt worden. Es handelt sich nicht um abschließende Informationen und ersetzt keine Beratung. Ob diese Informationen auch in Ihrem Fall zutreffen, kann nur zu einem Beratungstermin erörtert werden. Wir zeigen Ihnen die Vor- und Nachteile auf und geben Empfehlungen zur Gestaltung. Lassen Sie sich beraten!
Karsten Krause - Steuerberater
Adresse
Mihla
Lohfeldstraße 19
99831 Amt Creuzburg
Telefon 036924 4809-0
E-Mail info@krause-steuerberater.de